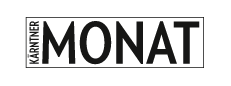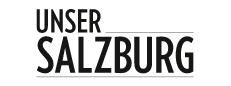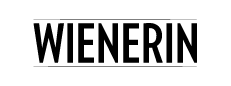© Unsplash/Stephanie Guarini
Grübeln, sorgen, analysieren: Mit Overthinking verbinden wir negative Gefühle und Gedanken. Diese Eigenschaft kann aber tatsächlich hilfreich sein, weiß Psychotherapeutin Barbara Haid.
“Du machst dir zu viele Gedanken.“ – Diesen Satz hört Theresa immer wieder, wenn sie anderen mitteilt, dass sie in einer Grübelschleife festhängt. Ihre Gedanken offen zu kommunizieren, fällt ihr nicht leicht und löst Schamgefühle aus, erklärt die 27-Jährige im Interview. „Ich bin ein klassischer Overthinker, analysiere Gespräche und habe oft Angst, etwas Falsches zu sagen“, gesteht sie. Aber nicht nur soziale Situationen geraten in den Fokus: „Ich versuche vor jeder Entscheidung die Sachlage von allen Seiten zu betrachten“, so die Wienerin.
Unterschiedliche Formen von Overthinking
Obwohl so ziemlich jede:r von sich behaupten würde, das Gleiche zu tun, nimmt das Sorgen und Grübeln bei Overthinkern Dimensionen an, die großen Leidensdruck erzeugen können, weiß Psychotherapeutin Mag. Barbara Haid. „Overthinking kann ein Teilsymptom einer Angststörung sein, findet sich aber auch bei depressiven Zustandsbildern und äußert sich oft über Schlaf- oder Essstörungen“, erklärt sie im Interview. „Betroffene geraten in einen Gedanken-Kreisverkehr, aus dem sie die Ausfahrt nicht mehr finden. Sie hinterfragen ihre Handlungen übermäßig viel, was zu einer großen Verunsicherung führen kann.“
Persönlichkeitsmerkmale, die mit diesem exzessiven Gedankenkreisen einhergehen, sind Perfektionismus und manchmal auch zwanghafte Züge. Die US-amerikanische Depressionsforscherin Susan Nolen-Hoeksema unterscheidet drei Formen des Grübelns: emotionales Beschweren, endloses Kreisen um Gründe des Scheiterns, das in Selbstabwertung mündet und chaotisches Overthinking, bei dem man von einem negativen Ereignis zum nächsten springt.
„Bei mir verschlechtert sich Overthinking je nach Zyklusphase“, erzählt Theresa. „Währen der PMS-Phase oder der Periode finde ich manchmal schwerer aus der Gedankenschleife. Eine Woche später belächle ich dann diese unnötige Grübelei wieder.“ Nach einer Psychotherapie kann die 27-Jährige mittlerweile ganz gut mit sorgenvollen Gedanken umgehen: „Ich weiß, woher dieses Grübeln kommt. Ich habe immer wieder mit Verlustängsten zu kämpfen und wurde als Kind oft für mein Verhalten kritisiert, weshalb ich mir jetzt als Erwachsene umso mehr Gedanken mache. Mittlerweile kann ich diese Ängste aber ganz gut lenken und mich meinen Freund:innen und meinem Partner anvertrauen“, sagt sie.
Ein offenes Gespräch gibt Theresa Sicherheit: „Bevor ich über eine Unterhaltung zu lange nachdenke, frage ich einfach nach, wie die andere Person das Gespräch wahrgenommen hat, oder gehe nochmal sicher, dass Aussagen von mir nicht falsch angekommen sind. Meine Mitmenschen sind das mittlerweile gewohnt“, erzählt Theresa lachend. „Dadurch weiß ich jetzt, dass sie sich nicht von mir entfernen, auch wenn ich einmal etwas Falsches sage.“
Perfektionismus verstärkt das Grübeln
„Overthinking wirkt sich auch auf viele soziale Interaktionen aus“, sagt Barbara Haid. „Menschen, die übermäßig grübeln, analysieren nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen.“ Begegnungen mit Freund:innen oder Familie werden dann genau unter die Lupe genommen: „Ein schiefer Blick kann das Gedankenkarussell ankurbeln. Jedes Wort und jede Geste wird auf die Goldwaage gelegt und kann diese Unsicherheit nähren. Das stellt Freundschaften manchmal auf die Probe“, erklärt die Psychotherapeutin. Und auch die Betroffenen selbst kann das Gedankenkreisen emotional erschöpfen: „Overthinker haben Angst, sich falsch zu entscheiden, kämpfen mit Selbstzweifel und entscheiden sich letzten Endes oft gar nicht“, so die Expertin. „Das Leitmotiv bei Angst vor Fehlern ist der Perfektionismus.“
In unserer Leistungsgesellschaft wird perfektionistisches Denken und Selbstoptimierung zusätzlich gefördert. Das kann Overthinker noch weiter antreiben: „In der Praxis sehen wir sehr oft, dass auch Soziale Medien eine starke Rolle spielen, da das eigene Leben im Vergleich zu anderen fast immer schlechter dasteht“, so Haid. Grundsätzlich sei Overthinking nicht etwas, was man aufhalten kann: „Es handelt sich um kein psychologisches Krankheitsbild, es ist viel eher etwas, das sich in eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen einreiht“, so die Therapeutin.
„Wichtig ist der richtige Umgang und die Dosierung, um den Leidensdruck zu reduzieren“, fügt Barbara Haid hinzu. Aber: Overthinking kann durchaus auch positiv genutzt werden. Analytisches Denken und mitfühlendes Verhalten haben nicht immer nur Nachteile.
Overthinking als Superkraft?
„Overthinker sind meistens sehr feinfühlig, empathisch und einfühlsam“, erklärt die Psychotherapeutin. Auch im Job ergeben sich Vorteile: Alle Eventualitäten abzuschätzen und gedanklich durchzugehen, bringt die Dinge voran: „Betroffene finden sich oft in der strategischen Planung, arbeiten oft als Analysten und sind auch in der Forschung gut aufgehoben.“ Im Overthinking liege auch viel kreatives Potenzial, weiß die Expertin.
„Wenn man Szenarien aus allen Blickwinkeln betrachtet, sehen Betroffene oft Details, die andere nicht sehen. Durch diesen Missing Link kann somit auch etwas Neues, Kreatives entstehen“, so Haid. Theresa setzt ihre Superkraft bei Verhandlungen und Diskussionen ein: „Vor schwierigen Gesprächen gehe ich mögliche Szenarien durch und ma che mich auf alle Eventualitäten mit passenden Gegenargumenten gefasst. Das bringt mich in manchen Situatio nen weiter – auch im privaten Bereich.“
Overthinker denken in alle möglichen Richtungen. „Es macht immer wieder Sinn, in diese Gedankenschleifen zu gehen, um sich einem Thema schrittweise anzunähern. Vor allem, wenn man dieses Nachdenken bewusst einsetzt“, sagt Barbara Haid. Die Diskussionsstärke und das kreative Potenzial entfalten sich nämlich noch besser, wenn es Overthinkern gelingt, ihre Gedanken mitanderen zu teilen, erklärt die Psychotherapeutin. „Oft sind sie damit alleine und kommen aus der wiederkehrenden Schleife nicht mehr heraus. Die Ge danken aufzuschreiben, um dem Kopf auch mal eine Pause zu gönnen, kann für Betroffene ebenfalls hilfreich sein.“
Das aktive Handeln gegen das Grübeln gibt einem außerdem ein Gefühl von Kontrolle. „Auch Übungen, um aus dem Kopf wieder in den Körper zu kommen, zum Beispiel autogenes Training und Muskelentspannungseinheiten können Overthinker dabei unterstützen, sich wohler zu fühlen“, empfiehlt die Expertin. „Im ersten Schritt ist es aber wichtig, sich bewusst darüber zu werden, dass man betroffen ist, um diese Muster erkennen und benennen zu können. Viele hören den Begriff in der Psychotherapie zum ersten Mal“, berichtet Haid.
Obwohl eine Therapie oder ein Coaching im Umgang mit dem Gedankenkarussell unterstützen können, ist Overthinking kein Krankheitsbild per se, stellt die Psychotherapeutin noch einmal klar. „Es ist vielmehr eine Verhaltensweise, bei der die Dosierung nicht stimmt.“ Wer einen angemessenen Umgang damit findet und Overthinking bewusst steuert, kann das Gedankenkarussell durchaus auch als Superpower nutzen.
Weitere Artikel zu diesem Thema
People
10 Min.
“Die Zukunft entsteht im Hier und Jetzt” – Trendforscher Harry Gatterer im Interview
Welche Trends unser Leben in den kommenden Jahren bestimmen und was es braucht, um darauf zu reagieren.
Welche Trends unser Leben in den kommenden Jahren bestimmen und was es braucht, um darauf zu reagieren, wollten wir von Trendforscher Harry Gatterer wissen. Er sagt: Die Zukunft ist kein Zufall, und Glaskugeln helfen auch nicht weiter. Die Zukunft hat derzeit keinen einfachen Stand. Wer die Zeitung aufschlägt oder durch den Newsticker scrollt, liest von … Continued
10 Min.
Mehr zu Business

Abo