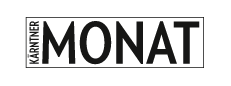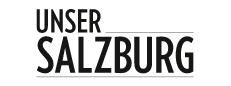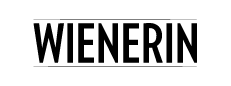“Adolescence” und Co: Kann man Kinder vorm Handy schützen?
Wie man eine gesunde Handynutzung lernt
© Pexels/Ron Lach
Nach schlaflosen Nächten nach der Serie „Adolescence“, vielen Texten dazu und Gesprächen mit Expertin Barbara Buchegger, mit Müttern und jungen Menschen aus unterschiedlichen Schulformen, die Erkenntnis: Wir sitzen in einem Boot und gewinnen in der digitalen Welt nur Land, wenn wir gemeinsam rudern.
Als meine Kinder klein waren, teilten sie sich ein Zimmer. Sie wurden größer, die Konflikte lauter, wir strukturierten um, sie bekamen jeweils ihr eigenes Reich. Von da an waren die Zimmertüren oft zu. „Wir dachten, in seinem Zimmer ist er sicher“, sagt der Vater in „Adolescence“, jener Netflix-Serie, die aktuell viele bewegt. Was darin passiert, ist schlimmer und näher, als es sich die meisten von uns vorstellen wollen. Die Aussage des Vaters fährt mir durch Mark und Bein. Ich überlege: Unterschätze ich die Gefahr? Habe ich meine Kinder gut auf die digitale Welt vorbereitet, die ich selber feiere, weil sie viele Türen öffnet, aber die mir auch Unbehagen bereitet, weil sie an vielen Stellen unkontrollierbar ist?
„Unser Sohn wird zwölf, nachts ist sein Handy gesperrt, tagsüber hört er gerne Hörspiele, er schaut ab und zu YouTube-Videos, abends spielt er FIFA am Tablet. Wir haben das Gefühl, dass er das gut im Griff hat. Es macht mir trotzdem Sorgen, wenn ich mitkriege, wie schnell Kinder, denen es eigentlich gut geht, wo reinrutschen können“, spricht mir die zweifache Mutter Elisabeth Kisela aus der Seele.
„Adolescence“ wühlt auch die Jungen auf. „Wie Themen ausarten können, macht mir Angst“, sagt Valerie, 15. „Ich finde vieles ziemlich gruselig, auch wie uns das Handy zuhört, oder dass Fotos und andere Dinge, die einmal im Internet gelandet sind, nur schwer zu löschen sind“, überlegt Sera, 17.
Eine Chance zum gemeinsamen Lernen am Handy
Während ich die Serie schaue, ist die Große auf einer Party und natürlich kenne ich dort nicht alle. Ich erzähle der Medienpädagogin Barbara Buchegger davon und sage: „Samstagnacht-Sorgen gibt’s seit Generationen, aber die digitale Welt erscheint grad übermächtig.“ – „Das ist sie nicht und durchaus vergleichbar mit dem Ausgehen, auch das überblicken wir als Eltern nicht“, sagt die pädagogische Leiterin der Initiative Saferinternet.at.
„Adolescence“ trifft mehrere wunde Punkte, erklärt Barbara Buchegger: Einerseits geht es um eine junge Generation, die in einem Zeitalter starker digitaler Verführungen aufwächst, und deren Leben Corona und andere große Krisen prägen. Andererseits um eine Elterngeneration, die ihre Kinder in einer Onlinewelt begleiten soll, obwohl sie selbst unsicher in der Nutzung ist. „Ich erlebe auch eine Änderung meines Jobs als Expertin. Es geht heute viel mehr darum, Sicherheit zu vermitteln, als weitere Unsicherheit zu schüren. Nach Sicherheit sehnen sich sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche.“ Wenn eine Serie Dinge aufzeigt, sei das gut, „aber ,Adolescence‘ vermittelt auch: Du hast als Eltern keine Chance. Das stimmt nicht. Wir haben eine Chance, mit unseren Kindern in Kontakt zu bleiben, wir müssen sie ergreifen.“
Gesprächsbasis schaffen
„Ich erinnere mich an die härteste Pubertätszeit eines meiner Kinder“, erzählt Barbara Buchegger. „Wir haben ein Leo gebraucht, wo wir uns nicht angeschrien haben. Gefunden haben wir es bei einem YouTuber, den wir gemeinsam geschaut haben.“
Die Gesprächsbasis müssen alle individuell für sich finden. „Das Wichtigste ist: sich dafür zu interessieren, was die Kinder tun und sich auch beeindrucken lassen. Wir alle haben in irgendeiner Form mit digitalen Medien zu tun, sie um Hilfe zu bitten, sie als Expert:innen hinzuzuziehen, kann auch eine Gesprächsbasis herstellen.“ Dass das im Abnabelungsprozess der Pubertät eine Herausforderung ist, liegt in der Natur der Sache.
Im Agieren der Eltern ist noch Luft nach oben, findet die Medienpädagogin: Wenn sie bei ihren Workshops in Volksschulen die Kinder fragt, wer ihre erste Ansprechperson ist, wenn sie Troubles haben, schreiben sie selten Mama oder Papa hin, und Jugendliche geben häufig an, von ihren Eltern in Bezug auf digitale Medien kaum begleitet worden zu sein.
Eine gute Strategie, um Kids zu schützen, ist Empowerment. Ein Beispiel: die Sorge um Fotos im digitalen Raum. „Ich beschäftige mich oft mit dem Thema Sexting: Es werden viele Nacktbilder ausgetauscht, nur ein kleiner Prozentsatz macht Probleme. Wenn Jugendliche wissen, wie sie sich wehren können, werden die Dinge eventuell nicht so dramatisch.“ Eine Ansage kann lauten: „Wenn du das Foto nicht sofort löschst, machst du dich strafbar – du kriegst eine Anzeige nach Strafgesetzbuch Paragraph 207a (Bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial und bildliche sexualbezogene Darstellungen minderjähriger Personen).“
Ein cleverer Konter kann auch sein: „Das bin ich nicht, das ist ein KI-generiertes Bild.“ „Wir haben leider tatsächlich erste Fälle, wo Jugendlichen das passiert ist: KI-generierte Deepnude-Fotos haben die Runde gemacht. Wer so ein Foto auf seinem Gerät hat, macht sich strafbar.“ Es gilt, die Jugendlichen so weit zu stärken, damit sie sich nicht erpressen lassen.
Gefahr (Cyber)Mobbing
Jamie, die 13-jährige Hauptfigur in „Adolescence“ wird zunächst Opfer von Cybermobbing, ehe er radikalisiert wird. Wir sind aber nicht machtlos gegen Cybermobbing: Soziale Medien wie Instagram haben Tools, um Profile und Kommentare zu melden, die beleidigen und diffamieren. „Soziale Netzwerke müssen laut Digital Services Act (Verordnung der EU, Anm.) darauf reagieren. Haben sie mehrere Meldungen vorliegen, erhöht das den Druck“, weiß Barbara Buchegger. Eine gute Anlaufstelle ist Rat auf Draht; die Mitarbeiter:innen unterstützen Betroffene und durch den Status „Trusted Flagger“ (vertrauenswürdiger Hinweisgeber, Anm.) führt eine Meldung schneller zum Ziel.
Das Perfide an Cybermobbing ist nicht nur, dass es schnell ein großes Publikum erreicht, „durch die Verfügbarkeit am Handy kann Cybermobbing jederzeit, auch in der Nacht passieren, das Zuhause ist kein Zufluchtsort“. Zumeist steht aber analoges Mobbing im Schulumfeld davor, das bestätigt eine Saferinternet-Umfrage. Trotzdem verschließen immer wieder Schulen die Augen davor, bedauert die Expertin. „Dabei gefährdet man den Ruf der Schule vielmehr, wenn man sich nicht gescheit damit beschäftigt.“ Sie weiß auch: Jugendliche zögern oft, ehe sie Hilfe holen, weil sie erleben, dass Erwachsene häufig unpassend reagieren und Situationen sogar verschlimmern. „Darum ist es so wichtig, dass sich Lehrende professionalisieren und eine No-Blame-Approach-Ausbildung (Ansatz ohne Beschuldigung, Anm.) machen.“
„Online trauen sich die Leute einfach mehr, ich hab’ auch schon rassistische und sexistische Beleidigungen innerhalb der Klasse mitgekriegt“, sagt Valerie, 15. Auch der 13-jährige Johannes kennt das, „aber die Gemeinheiten waren bei den Jüngeren schlimmer“, mit dem Älterwerden werde es weniger.
Was Cybergewalt bedeutet, musste die 17-jährige Sera vor Jahren selber erfahren. „Ich habe einem Jungen einen Korb gegeben, er konnte damit nicht umgehen“, erzählt sie. Daraufhin schickte er ihr Drohnachrichten, er wollte ihr was antun, schrieb er. „Ich bin sehr erschrocken und habe eine Zeit lang mein Handy gemieden. Ich wollte mich gar nicht damit befassen.“
Niemand sollte so etwas alleine durchmachen müssen, ist die Verbindung zu den Eltern gerade nicht ideal, gibt es viele Stellen, wohin man sich wenden kann. Die Wiener Beratungsstelle „Frauen* beraten Frauen*“ gab erst kürzlich ein kostenloses Handbuch zum Thema „Digitale Gewalt“ heraus.
Ist ein Handyverbot eine Lösung?
Ab 1. Mai gilt ein Handyverbot bis zur achten Schulstufe. Weil die Konzentration immer mehr litt, praktizieren das viele Schulen ohnehin schon länger, weiß Barbara Buchegger. „Die sozialen Netzwerke nehmen die Jüngeren immer mehr ein.“
„Wenn ich manchmal mein Handy aus der Hosentasche nehme und es ist voller neuer Nachrichten, nervt mich das manchmal. Aber ich schaue sie mir doch alle an“, sagt der 13-jährige Johannes. Er nützt zumeist Snapchat und WhatsApp, zum Spielen die Onlineplattform Roblox. Zwischen 20 Uhr abends und 6.30 Uhr morgens sind die Apps gesperrt, er verfügt über drei Stunden Bildschirmzeit. Dass seine Mama ihm TikTok vorerst verbietet, nimmt er ihr gar nicht übel, gesteht er.
Die 17-jährige Sera bekam ihr erstes Handy in der Volksschule, lange Zeit interessierte es sie nicht sonderlich. Mit etwa zwölf kippte die Sache. „Ich war viel in Sozialen Medien, blieb lange auf. Als meine Mutter mitgekriegt hat, dass ich immer müder wurde, musste ich abends eine Zeit lang mein Handy auf dem Küchentisch lassen. Unsere Elterngeneration hat das ganz gut gemacht, heute geht das zu früh los. Ich sehe oft Kleinkinder mit dem Handy in den Öffis.“
„Ich hatte früher Bildschirmzeiten von meinen Eltern, das lege ich mir mittlerweile selber auf, ich will mich im Griff haben“, erklärt Valerie. Sind ihre App-Zeiten aufgebraucht, könnte sie sie verlängern, „aber das ist unnötig. Ich kenne auch Leute, die fast nur noch am Handy sind“. Rund 28.000 16- bis 25-Jährige wurden für die Ö3 Jugendstudie befragt, die im April veröffentlicht wurde. Ein interessantes Ergebnis daraus: „67 Prozent empfinden Social Media als Zeitfresser, kommen aber nicht los davon.“
Medienerziehung, die möglichst früh ansetzt, könnte eine Lösung sein. Auch das Handyverbot bedeute nicht, dass das Thema für Lehrende vom Tisch sei, betont Barbara Buchegger. Integriert ist das Thema in unser Bildungssystem längst, es gibt das Grundfach Digitale Grundbildung und der Lehrplan ermögliche schon in der Volksschule, sich mit sozialen Netzwerken zu befassen, sozusagen noch bevor die Kinder sie aktiv nutzen. Doch was in diesen Einheiten passiert, hängt stark von den jeweiligen Lehrenden ab, „oft erleben Kinder, dass nur Programme rauf und runter geübt werden“.
„Unser Sohn hatte früher eine WhatsApp-Klassengruppe, die so aus dem Ruder lief, dass er ausgestiegen ist“, beschreibt die zweifache Mutter Elisabeth Kisela. „Jetzt hat er eine tolle Lehrerin für Digitale Grundbildung, es gibt eine Gruppe mit klaren Regeln, da wird nicht mehr reingespammt. Sie lehrt den Umgang mit Programmen, aber sie behandelt eben auch Themen wie Gaming oder Onlinehandel.“
Handynutzung in der Familie als Maßstab
Generelle Empfehlungen, ab wann Kinder ein Handy bekommen oder wie viel Zeit sie damit verbringen dürfen, hält die Medienpädagogin für wenig sinnvoll. „Es macht einen Unterschied, ob eine Familie zusammenwohnt oder ob ein Kind etwa zwischen getrennt lebenden Eltern pendelt. Das Bedürfnis berufstätiger Eltern, mit ihren Kindern in Kontakt zu sein, ist nachvollziehbar.“
Genauso lassen sich keine verallgemeinernden Aussagen darüber treffen, wie viel „Überwachung“ empfehlenswert sei. „Ich habe auch erlebt, dass sich Kinder zurückgesetzt fühlen, weil sie im Gegensatz zu Freund:innen nicht durch einen Google Family Link eingeschränkt werden. Eine Zwölfjährige erklärte mir: ,Meine Eltern lieben mich nicht, ich habe so etwas nicht.‘ “
Die Gefahr eines digitalen Kokons kann sein, dass sich die Kids daran gewöhnen, ihre Passwörter zu teilen. „Kinder müssen ab einem gewissen Zeitpunkt Hoheit über ihre Geräte haben, sie haben ein Recht auf Privatsphäre, dann kann nicht irgendwann ein Typ daherkommen und unter dem ,hab dich lieb‘-Mantel, die Gerätewartung übernehmen und gleich eine Stalkersoftware installieren.“
Bei der gut gemeinten elterlichen Überwachung schießen sich viele ein Eigentor, warnt die Expertin. „Was tut ein Vater, der mitkriegt, dass sein Sohn erpresst wird? Wenn er zugibt, dass er das weiß, ist das der Todesstoß für die Gesprächsbasis, seine Überwachung bringt ihm keinen Mehrwert. Es bringt Eltern auch nichts, Gesprächsverläufe anzuschauen, in der Regel können sie sie nicht einmal decodieren.“
„Ich hab’ kürzlich über die Bedeutungen von Emojis gelesen. Was da abgeht! Wie gut hatte ich es, ohne all dem aufgewachsen zu sein“, überlegt die zweifache Mutter Elisabeth Kisela. Tatsächlich gibt es bei der Verwendung von Emojis einen Jugendslang, ein Symbol kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Ein Beispiel: Die Schere kann für eine Gewaltandrohung stehen, aber ebenso lesbisch bedeuten. „Es interessiert mich, welche YouTube-Videos mein Sohn schaut, wir müssen achtsam sein, aber dürfen uns auch nicht verrückt machen“, sagt Elisabeth Kisela.
Was sich Kids wünschen
Warum ist es aber so, dass schon in der Volksschule – wie Barbara Buchegger schildert – viele Kinder nicht ihre Eltern als erste Bezugspersonen angeben, wenn sie digitale Troubles haben? „Weil sie von ihnen eher Strafen erwarten“, weiß die Medienpädagogin. Hier gelte es dringend, das Ruder herumzureißen. „Es bringt Kindern nichts, wenn sie sofort ausgeschimpft werden. Nehmen Sie das Kind in den Arm, trösten Sie es, dann kann man gemeinsam weitere Schritte für das jeweilige Problem überlegen. Kinder brauchen auch in der digitalen Welt eine lösungsorientierte liebevolle Begleitung.“
Und die Botschaft der Jungen?
- „Verbringt nicht zu viel Zeit am Handy!“, sagt Johannes, 13.
- „Ein Handy in der Volksschule ist ein No-Go“, findet Valerie, 15. Die Freiheit, später über das Handy selbstbestimmt verfügen zu können, hält sie für wichtig und betont gleichzeitig: „Das Leben ohne Handy ist ausgefüllter. Verbringt mehr Zeit mit Freund:innen, das bleibt in Erinnerung. Wenn ich mit einer Freundin telefoniere und sie dann in echt treffe, ist das kein Vergleich.“
- „Ich kriege mit, wie sich viele in kleinen Gruppen zum Spielen verabreden. – Geht lieber raus und sammelt echte Freundschaften“, sagt Sera, 17. „Und wenn du mit Freund:innen draußen bist, gib das Handy weg, ständig draufzuschauen ist einfach respektlos.“
Weitere Artikel zu diesem Thema
Abo